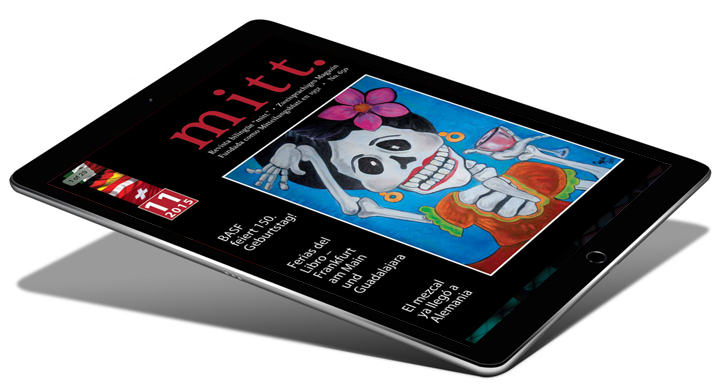|
Aber welche wissenschaftliche Fortschritte wurden in der Musiktheorie in verschiedenen Teilen der Welt erzielt und in welcher Form nehmen diese Einfluss auf unsere Stimmung und unsere Lust zu tanzen?
Bei der Musiktherapie geht es nicht nur darum, Musik zu hören. Es ist die Wissenschaft, die Klangkunst mit emotionaler, körperlicher und kognitiver Gesundheit verbindet. In Ländern wie Deutschland hat sich dieser Ansatz in der Praxis strukturiert und kreativ entwickelt und gezeigt, dass Klang eine positive Wirkung auf Körper und Seele hat, dass Rhythmus zu Therapie und der Drang zu tanzen zu einer tiefgreifenden Heilung führen können. Auf diese Weise begleitet uns Musik nicht nur, sie verwandelt uns auch.
Schon im Mutterleib bewegt Musik uns zutiefst und spornt uns immer zu Höchstleistungen an, außerdem hilft sie uns grundsätzlich, gesünder und glücklicher zu leben.
Neurowissenschaftler wie Peter Vuust und Stefan Kölsch erforschen das Geheimnis von Rhythmen und Melodien und untersuchen dabei die Funktion und Entwicklung unseres Gehirns. Kölsch, von der Universität Bergen in Norwegen, behauptet, dass „Musik unserem Körper hilft, unsere natürlichen Heilkräfte zu aktivieren, vielleicht sogar effektiver als viele Medikamente”.
In einer DW-Dokumentation (https://www.youtube.com/watch?v=9QNZqozcdNg) berichten die Befragten, dass „wir beim Kochen oft Lieder aus dem Radio mitsummen und den Rhythmus mitgehen, wenn ein für uns besonders mitreißender Song gespielt wird“.

Peter Vuust, vom Institut Music-in-the-Brain in Aarhus, Dänemark, hat dieses Phänomen untersucht und weiß, warum wir bei bestimmten Liedern nicht still sitzen können.
Wenn wir Sport treiben, können uns unsere Lieblingssongs dabei helfen, eine hohe Leistung zu erzielen. Tom Fritz, vom Max-Planck-Institut in Leipzig, hat herausgefunden, dass wir noch mehr leisten können, wenn wir während des Trainings in irgendeiner Form selbst Musik machen. Die DW-Dokumentation analysiert den positiven Einfluss, den Musik auf uns hat, von unserer frühesten Kindheit an, bis ins hohe Alter.
Musiktherapie ist keine alternative Disziplin mehr, sondern ein wissenschaftlich fundiertes Instrument, das in folgenden Bereichen eingesetzt wird:
• Therapeutische Anwendungen: Sie wird bei Patienten mit Alzheimer, Autismus, Parkinson, Sprachstörungen, Angstzuständen und Depressionen eingesetzt. Musik stimuliert bestimmte Bereiche des Gehirns, verbessert die Kommunikation und fördert die Entspannung.
• Technologie und Verfügbarkeit: Durch die Integration von mobilen Anwendungen, virtueller Realität und maßgeschneiderter Software haben mehr Menschen unabhängig von ihrem Standort Zugang zu therapeutischen Instrumenten sowie Behandlungen und auch Therapiesitzungen.
• Wissenschaftliche Forschung: Länder wie die Vereinigten Staaten von Amerika, Japan und Brasilien haben Studien über die Auswirkungen von Musik auf die Plastizität des Gehirns, die Schmerzlinderung und die postoperative Genesung veröffentlicht.
|
|

• Gemeinschaftlicher Ansatz: In Afrika beispielsweise wurden Programme entwickelt, bei denen Gruppengesang eingesetzt wird, um Traumata in von Konflikten betroffenen Gemeinschaften zu überwinden.
Insbesondere in Deutschland gab es bemerkenswerte Fortschritte und Innovationen, die dazu geführt haben, dass Musiktherapie zu einem integralen Bestandteil des Gesundheits- und Bildungssystems geworden ist. An Universitäten wie der Hochschule für Musik und Theater Hamburg werden spezialisierte Bachelor- und Masterstudiengänge angeboten, die Neurowissenschaften, Pädagogik und klinische Praxis miteinander verbinden.
• Anwendung bei älteren Menschen: Es wurden personalisierte Sitzungen für Menschen mit Demenz entwickelt, in denen mit musikalischer Improvisation, Chorgesang und auditivem Gedächtnis erfolgreich gearbeitet wird.
• Soziale Inklusion: Projekte in Berlin und München nutzen Musik, um Flüchtlinge zu integrieren, Jugendgewalt vorzubeugen und das emotionale Wohlbefinden in öffentlichen Schulen zu fördern.
• Symposien und interdisziplinäre Forschung: Veranstaltungen wie Musik und Demenz bringen Fachleute aus dem Gesundheitswesen, Therapeuten und Musiker zusammen, um Studien und Erfahrungen auszutauschen, die Kunst und Wissenschaft verbinden. Unabhängig vom therapeutischen Ansatz hat Musik einen von innen her wirkenden Einfluss auf unseren Körper und unsere Emotionen:
• Tanz und Neurochemie: Wenn wir zu einem Lied tanzen, das uns gefällt, werden Neurotransmitter wie Dopamin, Serotonin und Endorphine freigesetzt, die Freude, Selbstvertrauen und Vitalität erzeugen.
• Emotionale Synchronisation: Der Rhythmus kann sich unserem Gemütszustand anpassen, ihn verbessern oder uns helfen, schwierige Emotionen zu verarbeiten. Das Hören trauriger Musik kann kathartisch wirken, während ein fröhlicher Rhythmus energiefördernd wirkt.
• Körperlicher Ausdruck: Wenn wir uns im Takt der Musik bewegen, verbinden wir uns mit unseren Emotionen, lösen Spannungen und können „ohne Worte sprechen”.
• Soziale Verbindung: Das Tanzen in Gruppe stärkt das Einfühlungsvermögen, schafft Verbindungen und ermöglicht es, kollektive Gefühlszustände zu teilen, die das Wohlbefinden stärken.
Wie man sieht, geht es bei der Musiktherapie nicht nur darum, Musik zu hören. Es ist die Wissenschaft, die Klangkunst mit emotionaler, körperlicher und kognitiver Gesundheit verbindet. So begleitet uns Musik nicht nur, sondern macht uns auch gesünder.
|